Meine Erfahrung mit Fehlern beim Spracherwerb
uerst möchte ich mich entschuldigen und euch warnen. In diesem Artikel werde ich abschweifen. „Hablar pavadas“ sagen wir auf rioplatense Spanisch.
Ich spreche vier Sprachen mit unterschiedlichen Sprachkompetenzen. Spanisch ist meine Muttersprache. Englisch spreche ich – so behaupte ich zumindest – sehr gut, weil ich es seit meinem neunten Lebensjahr lerne und weil Muttersprachler, mit denen ich persönlich interagiert habe, mir das bestätigt haben. Außerdem habe ich keine Schwierigkeiten, ein normales Gespräch zu führen. Deutsch spreche ich gut, denn ich habe eine C1-Prüfung bestanden und benutze die Sprache regelmäßig. Manchmal muss mein Gehirn zwar wie ein Computer arbeiten, um auszudrücken, was ich sagen möchte, aber meistens gelingt es mir – auch wenn ich oft (sehr oft) auf Umschreibungen zurückgreifen muss und mein Gesprächspartner dann mit drei Wörtern das sagt, wofür ich vierundzwanzig gebraucht habe… Und Französisch. Mit dem Französischen kämpfe ich gerade, und ich muss zugeben, dass es diesen Kampf gewinnt. Die Aussprache ist so schwierig, dass ich beispielsweise beim Vokabellernen nicht vorankomme – und das, obwohl ich Spanisch spreche, eine weitere romanische Sprache! Aber wenn ich heute nach Frankreich reisen müsste, käme ich zumindest mit den grundlegenden Dingen gut zurecht – solange diese grundlegenden Dinge nicht den Subjonctif beinhalten.
Vor ein paar Jahren habe ich einen Deutschkurs in Dresden, Sachsen, Deutschland gemacht. Ich liebe es zu reisen, und wenn ich reise, mische ich mich gerne unter die Einheimischen, um mehr über ihre Kultur zu lernen. Außerdem mag ich dunkles Bier, also beschloss ich eines Abends in Dresden, in eine Bar zu gehen, um ein dunkles Bier zu trinken. Mein Deutschniveau war damals sehr niedrig, höchstens A2, und Deutsche sind sehr direkte Menschen, die Fehler nicht einfach übergehen. Das heißt, wenn man etwas falsch macht, sagen sie es einem. Die deutsche Sprache hat grammatische Fälle – etwas, das ich in diesem Artikel nicht erklären werde, weil ich mich sonst über 800 Seiten erstrecken würde. Der Punkt ist, dass diese Fälle Deklinationen erfordern, also dass sich viele Wörter je nach ihrer Funktion im Satz verändern. Zum Beispiel bedeutet „rojo“ auf Englisch „red“, und es bleibt immer „red“. Auf Deutsch sagt man „rot“, aber je nach Fall kann es sich in „rote“, „roter“, „roten“, „rotem“ oder „rotes“ verwandeln. Ich hoffe, ich habe keine Form vergessen. Aber es kommt noch schlimmer: Einige dieser Formen können maskulin, feminin, Singular oder Plural sein, je nach grammatischem Fall. Das heißt, „rojo, roja, rojos, rojas“, also auf Spanisch, ist dagegen ein Kinderspiel.
Jedenfalls bin ich in die Bar gegangen und habe geübt am Eingang, wie ich um eine Empfehlung für ein gutes dunkles Bier bitten konnte.
– Könnten Sie mir bitte ein gutes dunkel Bier empfehlen?
– Hast du dunkles gesagt?
Das war die Antwort – mit einem wenig freundlichen Gesichtsausdruck –, weil ich das Adjektiv „dunkel“ nicht dekliniert hatte. Warum erzähle ich diese Anekdote? Weil Fehler ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses des Fremdsprachenerwerbs sind. Und wir Menschen mögen es nicht, Fehler zu machen – es macht uns nervös, es ist uns peinlich. Das Problem ist jedoch genau das: Fehler gehören dazu. Wenn wir eine Sprache lernen, können wir nicht erwarten, sie erst perfekt zu beherrschen, bevor wir sie anwenden. Erstens, weil wir ohne Anwendung keine Fortschritte machen, und zweitens, weil es höchstwahrscheinlich ist, dass wir sie nie mit der Kompetenz eines Muttersprachlers sprechen werden. Tatsächlich ist es aus verschiedenen Gründen höchst unwahrscheinlich, dass wir als Erwachsene, wenn wir eine Fremdsprache lernen, die Kompetenz eines Muttersprachlers erreichen. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass nur 5 % der Erwachsenen, die beginnen, eine Fremdsprache zu lernen, dieses Niveau erreichen. Und sie werden als „das pathologische 5%“ bezeichnet. Im Grunde genommen möchte ich mit diesem Artikel vermitteln, dass man keine Angst vor Fehlern haben sollte – und wenn sich die Angst nicht vermeiden lässt, dann sollte man sich eben mit Angst irren. Und wenn man korrigiert wird, sollte man es annehmen. Schließlich helfen uns Korrekturen, besser zu werden, oder?
Eine weitere Strategie – und während ich schreibe, merke ich, dass ich in gewisser Weise gerade meine Frustration verarbeite – ist, sich nicht auf die Fehler zu konzentrieren. Das erhöht nur die Nervosität, wenn wir die Fremdsprache anwenden, die wir gerade lernen. Und in diesem Fall nehme ich mich selbst als Beispiel. Weiter oben habe ich erzählt, dass ich mit dem Französischen eher kämpfe als es lerne – und dass ich dabei verliere. Ich lerne Sprachen, weil es mir Spaß macht, und am Französischen gefällt mir besonders, wie es klingt. Ich liebe den Klang des Französischen. Aber wenn ich Französisch spreche, habe ich einen ausgeprägten spanischen Akzent – und deshalb hasse ich, wie ich klinge, wenn ich es spreche.
Warum haben wir einen fremden Akzent, wenn wir eine andere Sprache sprechen? Höchstwahrscheinlich haben wir beim Sprechen einer oder mehrerer Fremdsprachen einen Akzent. Das liegt daran, dass wir beim Erlernen einer neuen Sprache ihre Laute, ihre Intonation usw. an die ähnlichsten Muster anpassen, die es in unserer Muttersprache oder unseren Muttersprachen gibt. Und auch wenn viele Linguisten mir widersprechen und sagen würden, dass ich Unsinn rede (hablo pavadas), ist der fremde Akzent aus meiner bescheidenen Sicht die häufigste Art von Fehler beim Sprechen einer anderen Sprache – und diejenige, die am ehesten fossilisiert. Ich habe viele Erklärungen zur Fossilisierung von Fehlern gelesen, aber die, die mir am besten gefällt, ist folgende: Fossilisierte Fehler sind diejenigen, die unser Gehirn nicht korrigiert, weil sie die Kommunikation nicht verhindern. Denn es ist nicht unbedingt notwendig. Und im speziellen Fall des fremden Akzents ist es das in den meisten Fällen nicht. Es ist nicht dasselbe, Verben falsch zu konjugieren, Vokabeln zu verwechseln oder Reflexivpronomen zu vergessen, wie die Laute einer Sprache nur annähernd so auszusprechen, wie es die Muttersprachler tun. Und nach all dem kommen wir zurück zu meinem Französisch.
Wie ich bereits sagte, habe ich einen ausgeprägten spanischen Akzent, wenn ich Französisch spreche. Die französische Aussprache ist sehr schwierig. Sie hat zum Beispiel nasale Vokale, die in meiner Sprache nicht existieren, ist voller Ausnahmen und so weiter. Mir selbst passiert es dann, dass ich, wenn ich auf Französisch spreche und meinen eigenen fremden Akzent höre, mich so sehr auf meine Aussprachefehler konzentriere, dass ich einerseits oft nicht die richtigen Worte finde, um auszudrücken, was ich sagen möchte, weil ich völlig darauf fixiert bin, mich selbst zu hören. Und andererseits werde ich mir so bewusst, dass ich nicht so ausspreche, wie ich es gerne würde, dass ich am Ende noch schlechter ausspreche. Also, aus meiner Sicht – und in diesem Moment gebe ich mir selbst einen Rat – verlieren wir die Angst vor Fehlern und konzentrieren wir uns auf das, was wir gut machen, anstatt auf das, was wir falsch machen. Und lassen wir uns Fehler erlauben: Fehler zu machen und korrigiert zu werden ist ebenfalls eine Form des Fortschritts.



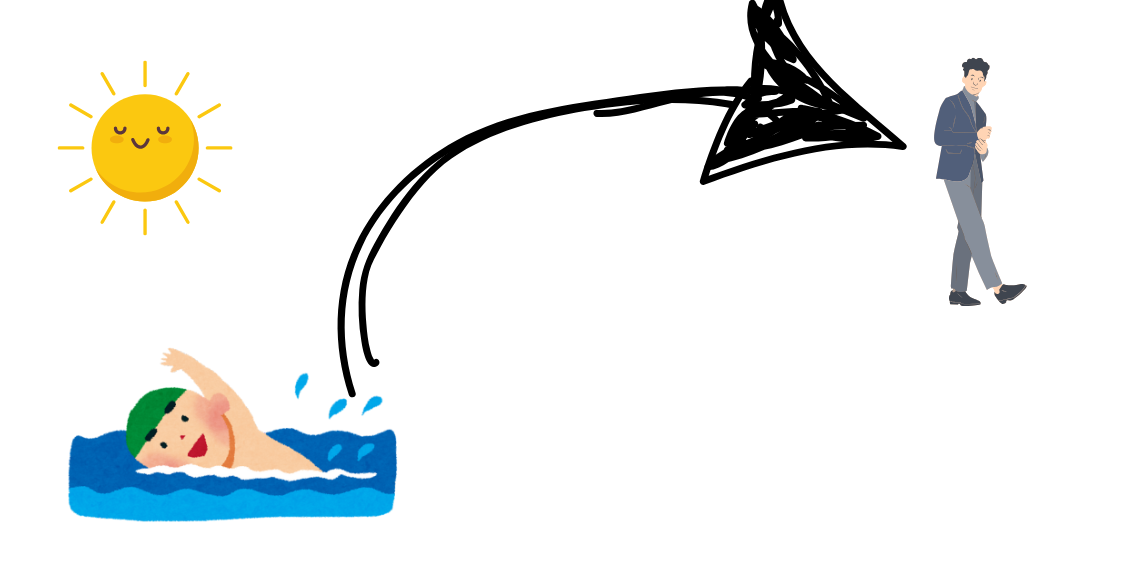

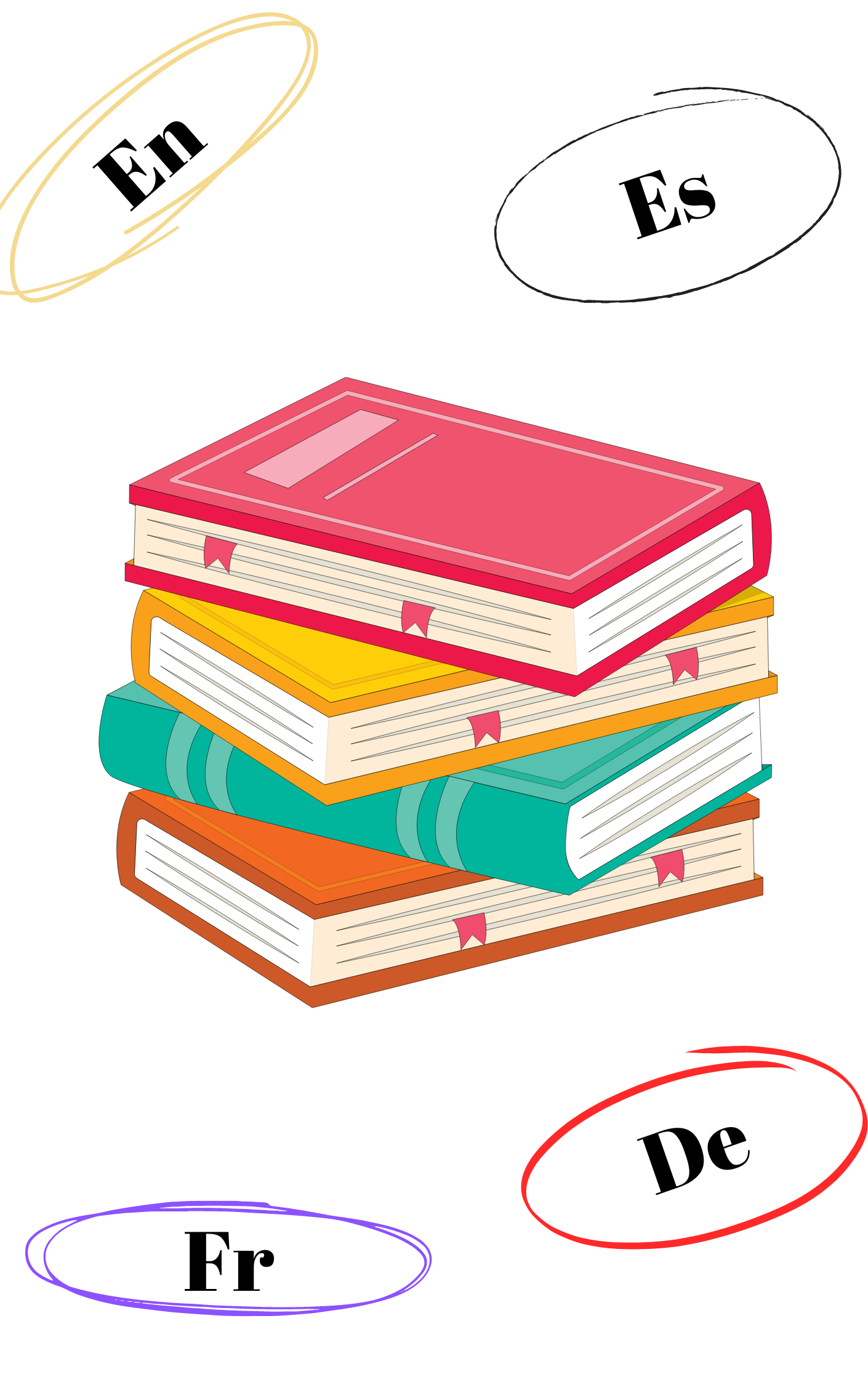
Schreibe einen Kommentar